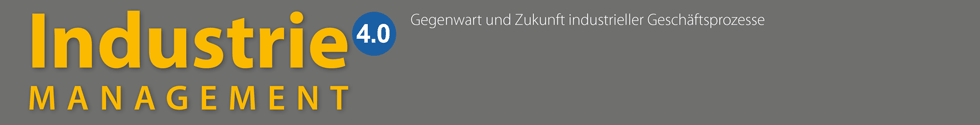Ohne Quoten verändert sich nichts
Zehn Menschen haben zehn Ideen. Wie unterschiedlich die sind, hängt davon ab, wie unterschiedlich die Menschen sind – wie divers. Andrea Dorothea Bührmann ist Gründungsdirektorin des Instituts für Diversitätsforschung an der Georg-August-Universität Göttingen. Ein Gespräch über Stereotype, innovative Ideen und warum Männer mit schlechten Noten Mathematik studieren – Frauen aber nicht.
Beginnen wir mit einer Begriffsklärung – was bedeutet divers?
Meistens meint man damit die Dimensionen von Diversität, die im Antidiskriminierungsgesetz genannt sind: Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Religion, Weltanschauung und ethnische Herkunft.
Schauen wir auf die Unternehmen. Wie divers sind die hierzulande?
Ich glaube, dass wir mittlerweile in den Belegschaften relativ viele Männer und Frauen haben. Wir haben relativ viele Menschen mit Migrationshintergrund und deswegen haben wir auch viele Menschen, die nicht christlich sind. Die Diversität hat natürlich auch etwas damit zu tun, in welcher Branche man unterwegs ist. In der Automobilbranche beispielsweise gibt es sehr viele Menschen in der Produktion mit Migrationshintergrund. Aber in den Führungsetagen sind es Männer mit bildungsbürgerlichem Hintergrund.
Und das immer noch überwiegend.
Ich bin mir sicher, dass sich das ändert. Vor allem deswegen, weil wir einen immensen Fach- und Führungskräftemangel haben, und dadurch insbesondere Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund mehr Chance haben, in Führungspositionen aufzusteigen.
Ist es für Unternehmen eine moralische Verpflichtung, Diversität zu fördern?
Nein, es ist eine gesetzliche Verpflichtung. Gesetzlich sind Unternehmen gezwungen, entlang des Antidiskriminierungsgesetzes entsprechende Aktivitäten zu entfalten. Das heißt: Bestimmte Gruppierungen dürfen nicht diskriminiert werden. Was dann aktiv gemacht wird – ob es ein Programm zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben gibt oder Sabbaticals möglich sind – ist gut für das Klima und die Kultur in einem Unternehmen. Gleichzeitig wird das im Rahmen der Corporate Social Identity auch genutzt. Unternehmen werben mit „Das wird alles in Deutschland gemacht“ oder „Wir setzen uns gegen Kinderarbeit ein“ oder „Wir setzen auf Diversität“. Das hat eine positive Wirkung, das zeigen auch Studien.
Was für eine positive Wirkung?
Es gibt in vielen Unternehmen mittlerweile Diversitäts-Beauftragte und Strategien dazu. Das ist ein Zeichen dafür, dass man anfängt, auf die Diversität der Beschäftigten und auch der Kundschaft einzugehen. Das hat einerseits Vorteile für den Marktzugang und für die Reputation des Unternehmens, andererseits aber auch den Vorteil, interessante Menschen rekrutieren zu können. Zudem arbeiten Menschen, die diskriminiert werden, nicht so gut; sie sind öfter krank und weniger engagiert. Wer Innovationen will, der braucht eine Perspektiven-Vielfalt. Von daher ist es wichtig, dass zumindest an bestimmten Stellen in Unternehmen diverse Teams zusammenarbeiten und so innovative Lösungen entstehen können. Früher dachte man, dass einfachste ist, wenn alle gleich sind. Dann hat man nicht so viel Ärger und kann leichter durchregieren. Ich glaube, dass sich die Management-Perspektive hier verändert.
Es geht also nicht mehr nur um das Durchregieren von oben nach unten?
Das würde ich so nicht sagen. Aber wir leben nicht mehr in modernen Industriegesellschaften, sondern in sogenannten spätmodernen internationalen und innovativen Wettbewerbsgesellschaften. Wir sind doch im Wettbewerb mit der ganzen Welt. Um da als großes Industrieunternehmen bestehen zu können, muss man innovative Lösungen suchen. Aus der Innovationsforschung wissen wir, dass es besser ist, nicht zehn ähnliche Menschen zusammenzubringen, sondern zehn, die sich möglichst unterscheiden und verschiedene Perspektiven mitbringen.
Und trotzdem haben es beispielsweise ältere Menschen noch immer schwer auf dem Arbeitsmarkt.
Ich habe gerade einen Idealfall beschrieben. Es gibt natürlich immer gute Gründe, nichts zu verändern. Meistens sind die, die für eine Veränderung sorgen könnten, selbst schon lange dabei. Und warum sollten die etwas verändern? Diese Beharrungskräfte sind ja noch da.
Das gilt auch für Menschen, die noch nicht lange dabei sind. In vielen Start-ups ist das Durchschnittsalter gerade einmal 30. Aus der Perspektive des Alters ist das nicht sehr divers.
Das hat etwas mit Stereotypen zu tun. Nicht alle Menschen über 40 sind weise und nicht alle Menschen unter 40 sind innovativ, mobil und gierig nach Neuem. Nicht alle Frauen sind friedliebend und nicht alle Männer sind aggressiv. Nicht alle Menschen aus der Türkei sind Muslime und nicht alle Menschen in Deutschland sind Christen. Das heißt, man muss sehr genau schauen, inwiefern Stereotype eine Rolle spielen.
Und wie wird man die los? Setzt hier das Diversity Management an?
Ja. Es gibt entsprechende Trainings, in denen man damit konfrontiert wird, welche eigenen Vorurteile man hat oder nicht hat. Gleichzeitig gibt es Tools, in denen man erleben kann, wie es ist, diskriminiert zu werden oder privilegiert zu sein. Das habe ich mit meinen Studierenden schon gemacht aber auch in Unternehmen. Dieses Erleben führt zu einem Aha-Effekt. Ein anderes wichtiges Instrument ist das Unconscious Bias Training. Damit macht man deutlich: Natürlich haben wir alle Vorteile und teilweise brauchen wir sie auch. Ohne Vorurteile könnten wir nicht durch das Leben gehen. Aber wir sollten sie trotzdem ab und zu überprüfen und schauen, ob sie so sinnvoll sind. Ich denke, das ist für Unternehmen eine große Chance.
Das hört sich nach viel Arbeit an, sich immer neu zu reflektieren.
Ja, das stimmt.
Wie sieht so etwas in der Praxis aus?
Es gibt doch in den Unternehmen Jahresgespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man könnte jede Führungskraft fragen: „Was haben Sie getan, um eine bestimmte Zielgruppe zu befördern?“ Dann kann man sehen, was getan wurde und was nicht. Danach sollten Gespräche darüber mit den Beschäftigten folgen. Ein wichtiger Punkt, der ja schon thematisiert wird, ist die Work-Life-Balance.
….also die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.
Wann finden beispielsweise Sitzungen statt? Nach 17 Uhr? Das ist die Zeit, in der sich Eltern um die Kinder kümmern. Hier ist die aktuelle Krise ein wichtiger Motor, weil wir begreifen, dass man viele Termine einfach per Videokonferenz machen kann.
Wie stehen Sie zu Quoten, da wo Freiwilligkeit nicht dazu führt, dass Frauen bestimmte Positionen erreichen?
Die finde ich gut. Alle Forschung zeigt: Ohne Quoten verändert sich nichts. Da ich noch in meiner Lebenszeit Veränderung wahrnehmen will, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht, bin ich für Quoten. Wenn man die erreicht hat, muss man sie natürlich abschaffen.
Die Technische Universität Eindhoven in den Niederlanden hat eine 100-Prozent-Frauenquote bei freien Stellen für Lehrende ausgerufen. Ist das ein richtiger oder zu extremer Weg?
Das ist extrem provokativ – und eine schöne Werbemaßnahme. Ich halte das ehrlich gesagt für falsch. Ich bin für Quoten um 40 Prozent in Deutschland. Ich denke, es ist wichtig, Korridore zu schaffen für andere extrem begabte Menschen, die nicht weiblich sind. Das ist auch eine philosophische Frage: Soll man Männer oder Diverse dafür bestrafen, dass Frauen in der Vergangenheit diskriminiert wurden? Das andere ist: Wir müssen viel früher ansetzen und uns Gedanken machen, wie wir unsere Kinder erziehen und sozialisieren. Wie kommt es, dass Frauen der festen Überzeugung sind, sie könnten nicht Mathematik studieren, und Männer das trotz schlechter Noten tun? Wir müssen also mit den Vorurteilsstrukturen viel früher anfangen. Davon würde nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Unternehmen profitieren – denn wir würden noch viel besser Talente erkennen.
Mehr von Andrea Dorothea Bührmann lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Industrie 4.0 Management: Das Managen von Diversität in agilen Unternehmen.
(Foto Copyright: Universität Göttingen/Christoph Mischke)