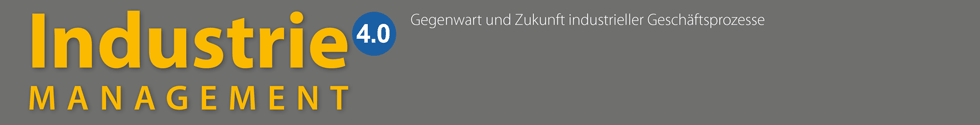Kostenlose Downloads
|
Carsten Fichter and Uwe Werner, Grüne Kraftstoffe, Grüner Wasserstoff , Grünes LNG, Energieversorgung, Schiffantrieb, Treibhausgasemissionen, Kreuzfahrt, Fahrgastschiff |
Heutzutage werden hauptsächlich Schweröl und Diesel als konventionelle Kraftsto e auf Fahrgastschiffen verwendet. Strenge internationale und insbesondere nationale regulatorische Rahmenbedingungen schränken zukünftig das Anlaufen eines Hafens mit konventionellen Kraftstoffen wesentlich ein. Hauptgründe dafür sind die hohen Emissionen solcher Kraftstoffe wie Kohlendioxid, Stickoxid, Schwefeloxid und Feinstaub. Grüne Gase (z. B. Wasserstoff ) und grüne Kraftstoffe (z. B. grünes Methanol) ermöglichen die Reduzierung dieser Emissionen. Wasserstoff kann für einen sicheren Betrieb zur Versorgung von Stromerzeugungs- und Antriebssystemen eingesetzt werden. Konventioneller Wasserstoff oder konventonelles LNG sind nicht CO2-frei. Mit grünem Wasserstoff , grünem Methanol, grünem Ammoniak und grünem LNG, basierend auf erneuerbarer elektrischer Energie, können die CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. In diesem Beitrag werden verschiedene grüne Kraftstoffe mit klassischen Kraftsto en in maritimen Anwendungen (hauptsächlich Fahrgastschiffbereich) in Bezug auf Vor- und Nachteile, Emissionen und Sicherheitsaspekte verglichen. |

|
|
Sebastian Trojahn und Vanessa Klementzki
Supply Chain Management, Erfolgsfaktoren, Resi- lienz, Digitalisierung, Kooperation, Nachhaltigkeit, Effzienz |
Die heutige Wirtschaftswelt ist durch eine stetig zunehmende Komplexität in verschiedensten Dimensionen gekennzeichnet: der Zusammenarbeit, dem Wettbewerb, der Beschaffenheit der Produkte bis hin zu steigenden Kundenanforderungen. Lieferketten sind schon längst nicht mehr linear zu begreifen, sondern bilden Netzwerke über zahlreiche Supply Chain Teilnehmer. Globalisierung und Krisen strapazieren dabei die bestehenden Strukturen, stellen bisher gesetzte Prioritäten und Maßnahmen in Frage und verlangen nach neuen Lösungen für (zukünftige) Probleme. Wie müssen Supply Chains in diesem sich stetig ändernden Umfeld mit Krisen und ständiger Komplexitätszunahme beschaffen sein, um erfolgreich zu sein? Dieser Beitrag stellt Handlungsfelder für erfolgreiches Supply Chain Management heraus und leitet daraus Erfolgsfaktoren und Eigenschaften ab. |

|
|
Tina Haase, Dirk Berndt, Wilhelm Termath und Michael Dick Digitale Assistenz- und Lernsysteme - Gestaltung lernförderlicher Systeme für die manuelle Montage |
Die Autoren stellen einen methodischen Ansatz für die lernförderliche Gestaltung von Assistenzsystemen vor und leiten Anforderungen an deren Gestaltung ab. Sie legen der Gestaltung dieser Systeme ein grundlegendes Verständnis der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine zugrunde, das Entscheidungen und Verantwortung auch weiterhin beim Menschen verortet. Abschließend zeigen die Autoren konkrete Erfordernisse und Maßnahmen eines partizipativen Gestaltungs- und Einführungsprozesses. |

|
|
Gergana Vladova und Norbert Gronau
KI-basierte Assistenzsysteme in betrieblichen Lernprozessen |
Assistenzsysteme finden im Kontext der digitalen Transformation immer mehr Einsatz. Sie können Beschäftigte in industriellen Produktionsprozessen sowohl in der Anlern- als auch in der aktiven Arbeitsphase unterstützen. Kompetenzen können so arbeitsplatz- und prozessnah sowie bedarfsorientiert aufgebaut werden. In diesem Beitrag wird der aktuelle Forschungsstand zu den Einsatzmöglichkeiten dieser Assistenzsysteme diskutiert und mit Beispielen illustriert. Es werden unter anderem auch Herausforderungen für den Einsatz aufgezeigt. Am Ende des Beitrags werden Potenziale für die zukünftige Nutzung von AS in industriellen Lernprozessen und für die Forschung identifiziert. |

|
|
David Bendig, Kevin Lau, Julian Schulte und Stefan Endriß
Industrie 5.0 - Die Europäische Kommission auf den Spuren der nächsten industriellen Revolution? |
Obgleich die Umsetzungsgeschwindigkeit und das Wissen zu Industrie 4.0 in den vergangenen Jahren merklich zugenommen haben, stehen viele Entscheidungsträger weiterhin vor wesentlichen Herausforderungen bei der Implementierung von Industrie 4.0-Technologien. Hohe Investitionen stehen unklaren Performance-Steigerungen gegenüber, es gibt noch immer kein allgemeingültiges Verständnis des Begriffs Industrie 4.0 und in vielen Fällen ist die Umsetzung nicht über ein initiales „Industrie 4.0-Leuchtturmprojekt“ in dem jeweiligen Unternehmen hinausgegangen [1]. Inmitten dieser Transformation veröffentlichte die Europäische Kommission im Januar 2021 ein Whitepaper mit dem Titel „Industry 5.0 - Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry” [2]. Kündigt sich hier somit bereits die nächste industrielle Revolution an? Dieser Beitrag erläutert den Begriff „Industrie 5.0“ in Bezug auf den Beitrag der Europäischen Kommission, die Verbindung mit aktuellen Industrie 4.0-Initiativen und zeigt dadurch Optionen für die Zukunft der industriellen Produktion auf. |

|
|
Marvin Müller und Joachim Metternich
Assistenzsysteme durch Natural Language Processing - Umsetzungsstrategien für den Shopfloor |
Die Werkstattführung im Rahmen des sogenannten Shopfloor Managements (SFM) greift zunehmend auf digital erfasste Daten zurück. Die im Rahmen des SFM erkannten Abweichungen führen im besten Fall zu einer systematischen und nachhaltigen Lösung der zugrundeliegenden Probleme. Besonders wertvoll ist dabei das in Form von Freitext dokumentierte Wissen der Beschäftigten in der Ursachenforschung und Maßnahmendefinition. Im Transferprojekt TexPrax werden daher Ansätze aus dem Natural Language Processing (NLP) auf diese Textdaten angewendet, um Assistenzfunktionen im SFM zu realisieren. Dieser Beitrag stellt verschiedene, erprobte Assistenzsysteme im digitalen SFM (dSFM) vor und zeigt situationsspezifische Umsetzungsstrategien für Unternehmen auf. |

|
|
Holger Dander, Patrick Adler und Gerd Witt Soziotechnisches Lernsystem am Arbeitsplatz - Förderung der Kompetenz von Mitarbeitenden durch soziotechnische Assistenzsysteme zum flexiblen Einsatz am Arbeitsplatz |
Die Komplexität manueller Tätigkeiten in unterschiedlichen Unternehmensbereichen steigt durch verkleinerte Losgrößen, höhere Produktvarianzen und kürzere Produktlebenszyklen. Besonders sind davon die manuell geprägten Bereiche in der Montage und Logistik betroffen. Das Anlernen von neuen Mitarbeitenden oder das Qualifizieren von vorhandenen Mitarbeitenden wird deshalb deutlich aufwendiger. Bei der Auslegung solcher Systeme ist jedoch nicht nur die zu nutzende Technik entscheidend, zur erfolgreichen Implementierung muss eine soziotechnische Systemgestaltung zur Anwendung kommen. Das im vorliegenden Beitrag vorzustellende System bietet in diesem Rahmen neuartige Möglichkeiten, indem das individuelle Lernverhalten über Lernkurventheorien abgebildet wird und die Art der Informationsbereitstellung steuert. |

|
|
Michael Schlecht, Jürgen Köbler und Roland de Guio
Flexibles Referenzmodell zur Planung und Optimierung der Produktion - Generierung digitaler Fabrikmodelle mit dem digitalen Zwilling |
Der digitale Zwilling dringt immer weiter in den Fokus von Produktionsunternehmen vor und wurde von Gartner als wichtige Schlüsseltechnologie identifiziert [1]. Volkswagen setzt die Technologie in der Cloud ein, um zukünftig die Produktion an allen Standorten digital zu planen, zu steuern und zu optimieren [2]. Dennoch ist diese Technologie im Mittelstand bisher kaum vertreten. Dieser Beitrag beschreibt ein flexibles Referenzmodell für die Planung und Optimierung der Produktion durch den digitalen Zwilling. Der Fokus liegt zum einen auf der Optimierung statischer Layouts und Materialflüsse und zum anderen auf der Optimierung der dynamischen Materialflüsse und der zeitlichen Organisation von Prozessen. |

|
|
Daniel-Leonhard Fox, André Ullrich und Norbert Gronau
Potenziale multimodaler Benutzungsschnittstellen - Ansätze der Mensch-Maschine-Interaktion für die digitalisierte Produktion |
Die Digitalisierung verändert Fertigung und Produktion nachhaltig. Dabei ist die konkrete Ausgestaltung von Benutzungsschnittstellen im digitalisierten Produktionsumfeld von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Transformation. In diesem Beitrag werden Einsatzpotenzial und Kombinationsmöglichkeiten von Ansätzen der Mensch-Maschine-Interaktion aufgezeigt sowie Anwendungsbeispiele vorgestellt. Dabei bieten multimodale Benutzungsschnittstellen einen hohen Grad an Immersion. Im Ergebnis werden Ansätze VR-, gesten- und sprachbasierter Interaktionsformen mithilfe der Grundsätze der Dialoggestaltung verglichen und deren Eignung im Einsatz als Arbeits- und Lernunterstützung für die Mitarbeiter dargestellt. |

|
|
Nico Hilgert und Frank Bertagnolli
Nachhaltige Problemlösung in digitalisierten Prozessen - Lean Management Umsetzung in der Logistik mittels datengestützter Prozessabsicherung |
Bei Lean-Management-Umsetzungen sollen Prozesse verbessert und Problemursachen nachhaltig beseitigt werden. In Bereichen mit vielen Daten, wie beispielsweise der Logistik, wird die Ursachenanalyse am Shopfloor jedoch unübersichtlich und kompliziert. Unterstützende Anwendungssysteme können bei der Analyse und dem „Führen am Ort der Wertschöpfung“ helfen. Am Beispiel der Versorgungslogistik der Automobilindustrie wird eine einfache digitale Lösung aufgezeigt, die Transparenz schafft, Zeit spart und zu einer nachhaltigen Problemlösung beiträgt. |

|
|
Christian Köhler und Tobias Mahl
Machbarkeitsanalyse hybrider Wertschöpfung - Ein Ansatz für die Analyse der Machbarkeit von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung im Kontext von KMU |
Die fortschreitende Verbreitung von vernetzten, intelligenten Produkten und Produktionsgütern im Rahmen von Industrie 4.0 verändert nicht nur die Produktion, sondern bewirkt auch die Entstehung von neuen Formen der Wertschöpfung und neuartigen Geschäftsmodellen. Unternehmen bietet dies die Möglichkeit zugehörige Dienstleistungen zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser Trend hin zum Angebot von integrierten Produkten und Dienstleistungen wird als hybride Wertschöpfung bezeichnet und zielt darauf ab, dem Kunden ganzheitliche und individuelle Lösungen anzubieten. Die Entwicklung eines zugehörigen Geschäftsmodells hybrider Wertschöpfung erfordert eine multikriterielle Machbarkeitsüberprüfung. Dieser Beitrag befasst sich mit den Besonderheiten der Machbarkeitsstudie von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung. |

|
|
Stefanie Lewandowski, André Ullrich und Norbert Gronau
Normen zur Berechnung des CO₂-Fußabdrucks - Ein Vergleich von PAS 2050, GHG Protocol und ISO 14067 |
CO₂-Fußabdrücke sind ein aktuell viel diskutiertes Thema mit weitreichenden Implikationen für Individuen als auch Unternehmen. Firmen können einen proaktiven Beitrag zur Transparenz leisten, indem der unternehmens- oder produktbezogene CO₂-Fußabdruck ausgewiesen wird. Ist der Entschluss gefasst einen CO₂-Fußabdruck auszuweisen und die entstehenden Treibhausgase zu erfassen, existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Normen und Zertifikate, wie die publicly available specification 2050, das Greenhouse Gas Protokoll oder die ISO 14067. Das Ziel dieses Beitrags ist es, diese drei Normen zur Berechnung des produktbezogenen CO₂-Fußabdrucks zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Vor- und Nachteile in der Anwendung aufzuzeigen. Die Übersicht soll Unternehmen bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Eignung eines CO₂-Fußabdrucks für ihr Unternehmen unterstützen. |

|
|
Ghada Elserafi, Adrian von Hayn und Matthias Weigold
Leistungsoptimierte Trocknung und Sauberkeit - Projekt LoTuS: Ansätze zur energetischen Optimierung von Reinigungsanlagen mit integrierter Trocknung |
Die Bedeutung der Bauteiltrocknung wächst mit steigenden Qualitätsanforderungen im metallverarbeitenden Gewerbe. Damit wächst das Erfordernis, den Energiebedarf von Trocknungsprozessen zu reduzieren. Im Forschungsprojekt LoTuS wird mit verschiedenen Ansätzen die Gestaltung einer Durchlaufreinigungsanlage mit energieeffizientem Trocknungsprozess angestrebt. Neben dem Einsatz alternativer Trocknungstechnologien soll eine Prozessdigitalisierung für einen bauteilspezifischen Prozess Transparenz bieten. Hier kommen, neben umfassender Sensorik, auch Methoden der künstlichen Intelligenz zum Einsatz, um eine praxistaugliche Prozessüberwachung zu entwickeln. Mithilfe eines intelligenten Lastmanagements sollen Lastspitzen der gesamten Anlage weiter gesenkt werden. |

|
|
Christian Ludwig, Thomas Farrenkopf, Thomas Panske und Hilmar Gensert Smart Factory im Werkzeugbau bei KAMAX - Reduzierung der Durchlaufzeit um 90 % |
Unter „Smart Factory“ wird die Vision einer Produktionsumgebung verstanden, in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne menschliche Eingriffe weitestgehend selbst organisieren [1]. Im Beitrag wird ein Projekt beschrieben, zu dessen Start keiner der Beteiligten das Thema „Smart Factory“ oder „Industrie 4.0“ auch nur ansatzweise mit dem Projekt in Verbindung brachte. Vielmehr wurde die Zielsetzung verfolgt, die heutige Lieferzeit von 6-8 Wochen drastisch zu reduzieren. Das Ergebnis ist ein vollständig digitalisierter Geschäftsprozess von der Auftragserstellung, der Produktentwicklung, der Konstruktion, der Fertigung sowie der Abwicklung für „Losgröße 1“ mit einer Reduzierung der Durchlaufzeit auf weniger als 10 %. |

|
|
Lucas Schreiber, Lea Vliegen, Jan-Philipp Jarmer, Andreas Günter und Christian Hohaus, David Grimm, Andrea Vennemann und Christian Fischer
Energieeffiziente Planung von Wertschöpfungsnetzwerken - Integration von Energieeffizienz in die strategische Gestaltung von Produktions- und Logistiknetzwerken |
Bei der Auswahl eines neuen Kühlschranks ist die Energieeffizienz heutzutage ein selbstverständliches Auswahlkriterium. In der strategischen und taktischen Planung von Wertschöpfungsnetzwerken ist dies noch nicht der Fall. Mit der im Forschungsprojekt E²-Design entwickelten Toolbox wird eine Berücksichtigung von Energieeffizienz neben den klassischen Leistungs- und Kostengrößen frühzeitig im Planungsprozess von Produktions- und Logistiknetzwerken ermöglicht. Im vorliegenden Beitrag werden die zugrundeliegenden Energiedaten und die entwickelten Planungswerkzeuge vorgestellt sowie der Nutzen aus Anwenderperspektive abgeleitet. Auf Basis des vorgestellten methodisch unterstützten Ansatzes ist es möglich, die grundlegenden Supply Chain Design (SCD)-Entscheidungen frühzeitig unter Berücksichtigung der Energieeffizienz zu treffen, um aus dem Gesamtpotenzial zu schöpfen. |

|
|
Kim Sprenger, Jan-Felix Klein, Marco Wurster, Nicole Stricker, Gisela Lanza und Kai Furmans
Industrie 4.0 im Remanufacturing - Analyse und Bewertung aktueller Forschungsansätze |
Das Remanufacturing, bisher geprägt durch manuelle und kostenintensive Prozesse, ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Industrie und Forschung sind sich einig, dass der Einzug von Industrie 4.0 Technologien den Schlüssel zu einer Entwicklung automatisierter und wirtschaftlicher Remanufacturing-Systeme darstellt. Basierend auf einer systematischen Literaturrecherche widmet sich dieser Beitrag der Analyse vielversprechender Industrie 4.0-Ansätze mit dem Fokus auf den übergeordneten Gesamtprozess sowie den Teilprozessen der Demontage und der Inspektion. Die Ergebnisse legen nahe, dass es an zusätzlichem Wissen, Erfahrung und Forschung bei der Entwicklung und realen Demonstration der Ansätze und deren Übertragbarkeit auf breitere Anwendungsfelder bedarf. |

|
|
Norbert Gronau
Modellieren des Umgangs mit Wissen für Industrie 4.0 |
Dieser Beitrag beschreibt eine Analyse- und Gestaltungsmethode für ein Mensch und Maschine integrierendes Wissensmanagement im Zeitalter von Industrie 4.0. |

|
|
Felix Krol, Birgit von See und Wolfgang Kersten
Digitalisierung messbar machen - Ein soziotechnisches KPI-Modell für die digitale Transformation |
Eine erfolgreiche digitale Transformation hin zum Zielbild der Industrie 4.0 ist heute bereits für viele Unternehmen ein entscheidendes Wettbewerbskriterium. Die anhaltende globale COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit der Digitalisierung in den Unternehmen deutlich gemacht und diese zusätzlich beschleunigt. Insbesondere in dieser Zeit sind die Unternehmen jedoch mit einer ungewissen Auftrags- und Ertragslage konfrontiert und müssen ihre Investitionsbudgets zielgerichtet einsetzen. Als Entscheidungsgrundlage bietet sich die Bestimmung der digitalen Reife mithilfe eines fundierten Kennzahlensystems an. Dieser Beitrag entwickelt ein solches soziotechnisches Digitalisierungs-KPI-Modell entlang der Dimensionen „Strategie und Führung“, „Digitalkompetenzen/Humankapital“ und „Intelligente Prozesse“. Das Modell kann zukünftig als Grundlage für die Bestimmung des digitalen Reifegrads und darauf aufbauend der Allokation von Digitalisierungs-Investitionen genutzt werden. |

|
|
Tim Scherzinger, Sabrina Guschlbauer, Fabian Diefenbach
IT-gestütztes Prozessmanagement - Entwicklungsstand und Anwendungsmöglichkeiten in der Baubranche |
Building Information Modeling (BIM)-Systeme repräsentieren einen ersten Schritt in Richtung eines digitalisierten und somit transparenteren Bauprozesses. Dabei wird jedoch aktuell meist nur die Planungsphase betrachtet. Somit müssen für die Bauphase oftmals zusätzliche Geschäftsprozessmodelle angefertigt werden. Diese Modelle sind nur selten mit einzelnen Geschäftsfällen verknüpft, sodass es schwerfällt, Aussagen über den Zustand eines laufenden Prozesses zu treffen, Kennzahlen zu erfassen oder den Prozess zu steuern und zu optimieren. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in eine Studie der Hochschule Esslingen mit dem Familienunternehmen LEONHARD WEISS, die die Einführung eines Workflow-Management-Systems in der Baubranche als möglichen Lösungsansatz untersucht hat. |

|
|
Sven Winkelhaus, Anke Sutter, Eric Grosse und Stefan Morana
Soziotechnische Systeme: Der Mensch in der Industrie 4.0 - Ein Vorgehensmodell zur Analyse |
Die Einführung neuer Technologien im Zuge von Industrie 4.0 verspricht umfangreiche Effizienz- und Qualitätssteigerungen. Jedoch verändert die Einführung neuer Technologien auch die Arbeitsumgebung für die Beschäftigten. Wird dies vernachlässigt, kann es zu nicht antizipierten negativen Auswirkungen auf das Gesamtsystem kommen. Eine ganzheitliche Sicht auf das soziotechnische System ist notwendig, um diese Effekte bereits bei der Planung zu erkennen und negativen Effekten vorzubeugen. Hierzu wird in diesem Beitrag ein Vorgehensmodell zur Analyse der sich bei der Einführung einer neuen Technologie ergebenen Effekte vorgestellt. Mit der dargestellten Vorgehensweise ist es möglich, strukturiert den Analyseprozess zu durchlaufen und individuell Maßnahmen abzuleiten, um das soziotechnische Gesamtsystem aktiv zu gestalten. |

|
|
Marco Huber, Tobias Nagel, Raphael Lamprecht und Florian Eiling
Potenziale von Reinforcement Learning für die Produktion |
Reinforcement Learning (RL) konnte bereits publikumswirksam in Video- und Strategiespielen beeindruckende Erfolge erzielen [1]. Diese Grundlagenforschung schafft die Grundlagen, dass RL für reale Entscheidungsprobleme in der Produktion nutzbar wird. Beispiele hierfür sind: Wie erhält ein Roboter mehr Intelligenz, um Aufgaben selbstständiger und ohne aufwendige Programmierung durchzuführen? In welcher Reihenfolge müssen Aufträge in einer Produktion abgearbeitet werden, um eine optimale Termintreue zu erhalten? Der Beitrag gibt eine Einführung in die Arbeitsweise des RL, sowie dessen bevorzugte Einsatzgebiete und beschreibt Anwendungsbeispiele aus dem produzierenden Alltag. Das präsentierte Überblickswissen über die aktuelle Forschung soll diesen Teilbereich der Künstlichen Intelligenz einem breiteren Interessentenkreis zugänglich machen. Übergeordnetes Ziel der beschriebenen Methoden ist, die Wertschöpfung am Wirtschaftsstandort Deutschland kontinuierlich zu steigern. |

|
|
Lukas Egbert, Anton Zitnikov, Thorsten Tietjen und Klaus-Dieter Thoben
Ansatz zur Zustandsbeschreibung technischer Bauteile - Prognose der Restnutzungsdauer basierend auf zeitdiskret erfassten Bauteilzuständen mithilfe mobiler Sensorik |
Dieser Beitrag beschreibt eine Herangehensweise für eine Predictive Maintenance-Lösung, bei der die Bauteilabnutzung technischer Systeme mithilfe eines Sensorik-Toolkits erfasst und mittels eines Prognosetools überwacht wird. Die Sensorik als auch das Prognosetool müssen flexibel ausgelegt sein, damit sie zielführend an unterschiedlichen technischen Systemen einsetzbar sind. Die Zustandsbestimmung der Bauteile erfolgt dabei nicht kontinuierlich, sondern basierend auf zeitdiskreten Messungen. Anhand der aufgenommenen Daten wird über ein Prognosemodell die wahrscheinliche Restnutzungsdauer der Bauteile prognostiziert. Für die Erstellung der Prognose dient ein Machine Learning Tool, welches mit historischen Abnutzungsverläufen trainiert wird. Die Trainingsdaten werden durch statistische Versuche erfasst, in denen die Einflussgrößen und charakteristische Verläufe verschiedener Abnutzungsarten identifiziert werden. Als Grundlage für diesen Beitrag dienen Untersuchungen an einem Rolltor, die im Rahmen des „LongLife“ Projekts durchgeführt wurden, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Das Forschungsvorhaben ist der Fördermaßnahme „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Innovative Produktkreisläufe“ (ReziProK) zugeordnet und hat eine Laufzeit von 36 Monaten. |

|
|
Chantal Mause, Rahel Kröhnert und Dieter Uckelmann
securPharm - Die Absicherung der pharmazeutischen Lieferkette |
Ca. 10% der in Umlauf gebrachten Arzneimittel in Ländern mit geringem bis mittleren Einkommen waren 2017 gefälscht [1]. Diesem hohen Fälschungsumfang beugt das securPharm-System in Deutschland vor. Es ermöglicht, Fälschungen entlang der Lieferkette zu identifizieren und deren Abgabe zu stoppen. Die Überprüfung erfolgt EU-weit über Ländergrenzen hinweg durch ein Datenspeicher- und abrufsystem. Aufgrund einiger systembezogener Schwierigkeiten ist das System in Apotheken dennoch nicht gänzlich akzeptiert. Eine zusätzliche Problematik bildet der Onlinehandel, der nicht in gleichem Maße abgesichert werden kann wie der stationäre Handel. Ein abschließender tabellarischer Vergleich mit dem US-amerikanischen System zeigt, dass es dem europäischen in nahezu allen Punkten gleicht. |

|
|
Florian Dörries, Marco Wichering und Wolfgang Kersten
Das Change Management weiterentwickeln - Aktuelle Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Anpassungen für die digitale Transformation |
Unternehmen stehen vor dem Hintergrund der digitalen Transformation vor einschneidenden Veränderungen, die den Unternehmenserfolg beeinflussen können. Change Management kann die Unternehmen unterstützen, diese Transformation erfolgreich umzusetzen und somit der Gefahr zu entgehen, bspw. Marktanteile an innovationskräftigere Unternehmen zu verlieren. Die damit einhergehende Fragestellung ist allerdings, inwiefern die tradierten Modelle des Change Managements passend für den anstehenden Wandel sind und ob diese weiterentwickelt werden müssen. In diesem Beitrag werden mithilfe einer Literaturanalyse sowie einer Befragung aktuelle Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Change Managements identifiziert, wodurch im Anschluss ein angepasstes Modell für erfolgreiche Change-Projekte abgeleitet werden kann. |

|
|
Werner Gleißner, Endre Kamarás und Marco Wolfrum
Quantifizierung des Adressausfallrisikos in der Krise - Risiken aus der Insolvenz von Lieferanten und Kunden |
Schwere Wirtschaftskrisen führen zu einem deutlichen Anstieg der Häufigkeit von Insolvenzen der Unternehmen. Die Insolvenz eines Unternehmens hat wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf andere Unternehmen, denen damit wesentliche Kunden oder Lieferanten verloren gehen. Für das Risikomanagement, die Quantifizierung der Risiken und die Initiierung von Bewältigungsmaßnahmen ist es gerade in einer Krise besonders wichtig, die Insolvenzrisiken von Geschäftspartnern (Adressausfallrisiken) sachgerecht einzuschätzen. Wesentlich ist hierbei, dass die Insolvenzrisiken von Unternehmen nicht unabhängig zu sehen sind, sondern dass es eine erhebliche systematische Komponente gibt, insbesondere durch den Nachfragerückgang in der Volkswirtschaft (in Abhängigkeit des Krisenverlaufs; siehe [13] und [14]). Die wesentlichen Herausforderungen und Lösungsstrategien werden nachfolgend skizziert. |

|
|
Patrick Oetjegerdes, Christian Weckenborg und Thomas S. Spengler
Iterative optimierungsbasierte Simulation - Entscheidungsunterstützung in der hierarchischen Planung komplexer Produktions- und Logistiksysteme |
Werden Anpassungen von Produktionssystemen geplant, beispielsweise der Bau einer neuen Anlage, werden häufig Simulationen für die Prognose der damit verbundenen Auswirkungen genutzt. So wird die Basis für eine betriebswirtschaftliche Bewertung geschaffen. Für die Erstellung der Modelle werden Entscheidungsprozesse der Produktionsplanung und -steuerung in der Simulation dargestellt, beispielsweise die Reihenfolgenplanung einer Anlage. Diese Übertragung der Entscheidungsprozesse in die Simulation führt zu einem hohen Aufwand für die Erstellung von Simulationsmodellen. Dieser Aufwand kann durch die Nutzung iterativer optimierungsbasierter Simulationen verringert werden, da hier auf bereits existierende Prozesse zurückgegriff en wird. Statt Entscheidungsprozesse in der Simulation neu zu modellieren und lösen, wird die Simulation mit Optimierungsverfahren gekoppelt, die auch im realen System zur Entscheidungsfi ndung genutzt werden. Dieses Konzept wird bei einem Stahlhersteller angewendet und es wird gezeigt, dass so verschiedene operative bis taktische Anpassungen bewertet werden können. |

|
|
Manuel Rupprecht
Globale Wertschöpfungsketten in Zeiten von Covid-19 - Wie lässt sich die damit verbundene Unsicherheit reduzieren? |
Das SARS-CoV-2-Virus stellt die Weltwirtschaft vor ungeahnte Herausforderungen. Nie zuvor geriet das Wirtschaftsgeschehen so schnell, so stark und von so vielen Seiten gleichzeitig unter Druck. Die Nachfrage nach Gütern brach ein, weil sich Konsumenten – teils gezwungenermaßen – zurückhielten, und das Angebot ging zurück, weil den Unternehmen plötzlich Mitarbeiter oder Vorprodukte fehlten. Infolgedessen drehten sämtliche Konjunkturindikatoren abrupt ins Negative. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung erreichte dagegen Rekordhöhen. Inzwischen scheint die wirtschaftliche Talsohle zwar durchschritten, doch die Unsicherheit bleibt hoch. Dies hängt nicht zuletzt mit der Bedeutung globaler Wertschöpfungsketten zusammen. Deren Störung trug maßgeblich zu den genannten Verwerfungen auf der Angebotsseite bei; für die lokale Produktion sind sie jedoch bis heute zentral. Der Beitrag diskutiert die skizzierten Entwicklungen und zeigt Möglichkeiten für eine Reduktion der Anfälligkeit von Wertschöpfungsketten und einen damit verbundenen Abbau der Unsicherheit auf. |

|
|
Johannes Schnelle, Henning Schöpper und Wolfgang Kersten
Corona: Katalysator für Digitalisierung und Transparenz? Eine Studie über die Auswirkungen der Pandemie |
Die Corona-Krise hatte einen unübersehbaren Einfluss auf die Beschaffungssituation in den globalen Lieferketten, an den sich die Unternehmen schnell anpassen mussten. Die Auswirkungen verdeutlichen, dass sich die Unternehmen zur Reduzierung der Risiken mit der Struktur und der Transparenz in den Lieferketten beschäftigen müssen. Im folgenden Beitrag wird untersucht, über welche Kenntnisse die Akteure verfügen und wie sie diese durch die Digitalisierung verbessern wollen. Die Ergebnisse belegen, dass die Unternehmen bisher nur über geringe Kenntnisse jenseits ihrer direkten Lieferanten verfügen, jedoch zunehmend in der Lage sind, an benötigte Daten aus der Lieferkette zu gelangen. Zugleich zeigen die Ergebnisse, dass noch Potenzial zur Steigerung der Transparenz und der Nutzung von Daten vorhanden ist. |

|
|
Christof Thim, André Ullrich, Felix Eigelshoven, Norbert Gronau und Ann-Carolin Ritter
Crowdsourcing bei industriellen Innovationen - Lösungsansätze und Herausforderung für KMU |
Die Innovationstätigkeit im industriellen Umfeld verlagert sich durch die Digitalisierung hin zu Produkt-Service-Systemen. Kleine und mittlere Unternehmen haben sich in ihrer Entwicklungstätigkeit bisher stark auf die Produktentwicklung bezogen. Der Umstieg auf „smarte“ Produkte und die Kopplung an Dienstleistungen erfordert häufi g personelle und fi nanzielle Ressourcen, welche KMU nicht aufbringen können. Crowdsourcing stellt eine Möglichkeit dar, den Innovationsprozess für externe Akteure zu öff nen und Kosten- sowie Geschwindigkeitsvorteile zu realisieren. Bei der Integration von Crowdsourcing-Elementen ist jedoch einigen Herausforderungen zu begegnen. Dieser Beitrag zeigt sowohl die Potenziale als auch die Barrieren einer Crowdsourcing-Nutzung im industriellen Umfeld auf. |

|
|
Patrick Schumacher, Christian Weckenborg, Thomas S. Spengler, David Schneider, Tobias Huth und Thomas Vietor
Das Potenzial-Modell - Eine Methode zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Industrie 4.0-Lösungen |
Durch die zunehmende Digitalisierung der Wertschöpfungskette werden Unternehmen mit neuen Herausforderungen, wie etwa einer höheren Variantenvielfalt oder steigenden Individualisierungswünschen von Kunden, konfrontiert. Zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen bietet die Implementierung von Industrie 4.0-Lösungen großes Potenzial. Dennoch agieren gerade kleine und mittlere Unternehmen bei deren Einführung zurückhaltend. Dies ist vor allem auf den hohen fi nanziellen Aufwand für Industrie 4.0-Lösungen und eine unzureichende Abschätzbarkeit der Auswirkungen ihrer Einführung zurückzuführen. Im Rahmen des EFRE-Forschungsprojekts »Synus« wurden Methoden und Tools zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Bewertung und Auswahl von Industrie 4.0-Lösungen entwickelt. Inhalt dieses Beitrags ist die Präsentation des Potenzial-Modells, welches kleine und mittlere Unternehmen zur Auswahl geeigneter Industrie 4.0-Lösungen in Abhängigkeit der individuellen Sachlagen und Präferenzen befähigt. |

|
|
Daniel Roy und Matthias Fellenberg
Logistikplattformen als Treiber für smarte Ökosysteme - Supply Chain Visibility als initialer Schritt für Transparenz und Steuerung von integrierten Real-time Supply Chains |
Märkte sind durch den Megatrend der Plattformisierung erheblichen Veränderungen ausgesetzt [1]. Für zuvor isolierte Märkte, wie z. B. Smart Factory, Smart Logistics oder Smart Grids bietet sich dadurch das Potenzial, vernetzt „smarte Ökosysteme“ entstehen zu lassen. Logistikplattformen als Instrument der Vernetzung sind ein wesentlicher Treiber für diese Plattformökonomie. In der Anwendung für Supply Chain Visibility fördern Logistikplattformen die Transparenz und Steuerung von Logistikketten und stellen dadurch einen wesentlichen ersten Schritt hin zu smarten Ökosystemen dar. |

|
|
Andreas Baum, Chiara Armbruster, und Carlo Burkhardt
Lithography-based Metal Manufacturing - Ein additives Fertigungsverfahren zur Herstellung höchstpräziser, kleiner Metallbauteile |
Additive Fertigungsverfahren, umgangssprachlich auch 3D-Druck genannt, gehören seit einigen Jahren zu den Megatrends der modernen industriellen Fertigung. Vielfältige, branchenspezifi sche Anforderungsprofi le führten so zu einer großen Anzahl an unterschiedlichen additiven Fertigungsverfahren und -verfahrensvarianten mit großer Werkstoff vielfalt. Bei erfolgreicher Identifi kation der jeweils geeigneten Technologie ermöglicht deren Einsatz dem Anwender Vorteile wie Funktionsintegration, Leichtbau oder Effi zienzsteigerungen. Allerdings stehen viele additive Fertigungsverfahren vor technologischen und vor allem wirtschaftlichen Herausforderungen, die ihren breiten industriellen Einsatz zum aktuellen Zeitpunkt hemmen. Hier bietet die innovative Lithography-based Metal Manufacturing-Technologie (LMM) neue Möglichkeiten und Chancen, insbesondere für die wirtschaftliche Herstellung von kleinen und kleinsten metallischen Präzisionsbauteilen mit hohen Genauigkeitsanforderungen. |

|
|
Thomas Papke, Dominic Bartels, Michael Schmidt, Marion Merklein, Daniel Gerhard, Jonas Baumann und Indra Pitz
Additive Fertigung für industrielle Anwendungen - Entwicklung einer Auswahlsystematik für Bauteile zur Generierung funktionalen Mehrwerts mittels additiver Fertigung |
Durch hohe Gestaltungsfreiheit und den Entfall produktspezifischer Werkzeuge gewinnen additive Fertigungsprozesse im industriellen Umfeld immer stärker an Bedeutung. Mit der Ausnutzung der verfahrensspezifischen Vorteile gegenüber konventionellen Fertigungsverfahren kann ein Mehrwert für Bauteile und Produkte generiert werden. Allerdings stellt die Auswahl potenzieller Bauteile, die durch die additive Fertigung einen Mehrwert erhalten können, eine Herausforderung dar. Zu diesem Zweck wurde eine Auswahlsystematik erarbeitet, um das Potenzial zu quantifizieren. Darauf aufbauend wird ein Ansatz vorgestellt, mit welchem beginnend mit der Bauteilauswahl über die Bauteil- und Prozesskettengestaltung eine Bewertung des Mehrwerts möglich ist. Dieser wird abschließend auf ein Strukturbauteil eines Fahrzeugs angewendet. |

|
|
Philipp Blattert, Rouven Müller und Werner Engeln
Produkte agil entwickeln mithilfe Additiver Fertigung - Ein Ansatz zur besseren Kundenorientierung bei der Entwicklung physischer Produkte |
Viele Industrieunternehmen sind auf der Suche nach neuen Strategien für eine zukunftsichernde Produktentwicklung. Die Ursache hierfür liegt in verschiedensten Herausforderungen und Trends der heutigen Arbeitswelt. Hierzu zählen die zunehmende Vernetzung der Wirtschaft, die Individualisierung und schnelle Änderung von Kundenwünschen, die Verbreitung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die immer kürzer werdenden Innovations- und Technologielebenszyklen. Die heutige Entwicklungsumgebung in Unternehmen, mit meist starren Abteilungsstrukturen, geringer Kommunikation mit den Kunden und zwischen den Abteilungen sowie der späten Auslieferung von fertig entwickelten Produkten wird den Anforderungen nicht mehr gerecht. In diesem Zusammenhang rücken agile Vorgehensweisen gepaart mit additiven Fertigungsverfahren in den Fokus der Entwicklung. |

|
|
Christian Kukla, Stephan Schuschnigg und Clemens Holzer
Additive Fertigung metallischer und keramischer Bauteile - Einsatz der Materialextrusion insbesondere der Verwendung von Filamenten für Sinterverfahren |
Die Herstellung von metallischen oder keramischen Komponenten mit der Materialextrusion ist noch wenig bekannt und die im Bereich der Kunststoff e am weitesten verbreitete, der Filamentdruck, wird hier beschrieben. Er basiert auf der Verwendung hochgefüllter Kunststoff e, ähnlich wie sie auch beim Pulverspritzguss (PIM) Einsatz fi nden. Der Pulveranteil liegt dabei idealerweise im Bereich von rund 60 vol. %. Im folgenden Beitrag werden für dieses Verfahren die einsetzbaren Werkstoff e, die Herstellung der Filamente, das Drucken, Entbindern, Sintern und mögliche Nachbearbeitungsschritte beschrieben. |

|
|
Sven Winkelhaus, Eric Grosse und Michael Bauer
Digitale Verzahnung in variantenreicher Fertigung - Komplexe Produktions- und Logistikprozesse mittels mobiler Apps harmonisieren |
Industrie 4.0 und Logistik 4.0 sind Phänomene, die in vielen Branchen sowohl die strategische Ausrichtung von Unternehmen als auch die operativen Prozesse prägen. Neben paradigmatischen Veränderungen sind insbesondere technische Lösungen im Fokus dieser Entwicklung. Mittels neuer Technologien kann die Komplexität individualisierter Produkte und komplexer Prozesse handhabbar werden. Auf Shopfl oorebene können unbekannte Technologien jedoch auf Widerstand bei der Implementierung stoßen. Hier bieten Apps für mobile Endgeräte eine geeignete Möglichkeit, Produktions- und Logistikprozesse im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie mitarbeiterfreundlich zu unterstützen. In diesem Beitrag wird die Verzahnung von Produktion und Logistik in der Industrie 4.0 näher beleuchtet und ein Fokus auf die Mitarbeitenden in dieser Entwicklung gelegt. An einem Beispiel wird verdeutlicht, wie Apps zu einer erfolgreichen digitalen Transformation beitragen können. |

|
|
Jürgen Köbler, Tobias Fischer, Benjamin Klerch und Michael Schlecht Industrie 4.0 - Der Weg zu einem digitalisierten Produktionsunternehmen |
Das Zeitalter der Digitalisierung ist geprägt durch einen erhöhten Wettbewerb. Eine Chance bei steigendem Wettbewerb erfolgreich zu bestehen, liegt daher nur in der durchgängigen Digitalisierung von Produktionsunternehmen. Dieser Beitrag widmet sich der Gestaltung einer dreistufi gen generischen Unternehmensmodellplattform Industrie 4.0, die die Durchgängigkeit von Prozessen vom Kunden bis zum Lieferanten auf allen Unternehmensebenen in den Mittelpunkt stellt. Es folgt eine Übersicht der Transformationsschritte zur Bewertung und Gestaltung des Fortschritts auf dem Weg zum digitalisierten Produktionsunternehmen. |

|
|
Gergana Vladova, Philip Wotschack, Patricia de Paiva Lareiro, Norbert Gronau und Christof Thim
Lernen mit Assistenzsystemen - Vor lauter Aufgaben den Prozess nicht sehen? |
Der Beitrag beschreibt die Konzeption und Durchführung und bietet einen Einblick in die ersten Ergebnisse einer Untersuchung mit experimentellem Design in einer simulierten Prozessumgebung im Forschungs- und Anwendungszentrum Industrie 4.0 in Potsdam. Im Mittelpunkt stehen Anlernprozesse im Bereich der Einfacharbeit (Helfertätigkeiten) und ihre Gestaltung durch den Einsatz digitaler Assistenzsysteme. In der Arbeitsforschung finden sich Hinweise darauf, dass mit dem Einsatz dieser Systeme Prozesswissen verloren geht, im Sinne einer guten Kenntnis des gesamten Arbeitsprozesses, in den die einzelnen Tätigkeiten eingebettet sind. Das kann sich als Problem erweisen, vor allem wenn unvorhersehbare Situationen oder Fehler eintreten. Um die Rolle von Prozesswissen beim Einsatz von digitalen Assistenzsystemen zu untersuchen, wird im Experiment eine echte Fabriksituation simuliert. Die Probanden werden über ein Assistenzsystem Schritt für Schritt in ihre Aufgabentätigkeit angelernt, einem Teil der Probanden wird allerdings am Anfang zusätzlich Prozesswissen im Rahmen einer kurzen Schulung vermittelt. |

|
|
Tobias Fischer und Benedikt Schmieder Lean-IT - Anwendbarkeit bewährter Lean-Management-Methoden in der Unternehmens-IT |
Der Einsatz bewährter Prinzipien und Methoden des Lean-Managements in der Unternehmens-IT kann inzwischen als machbar und sinnvoll angesehen werden. Für eine Anwendung in der Breite fehlt es jedoch bisher an einer direkten Verknüpfung zwischen Lean-Werkzeugen und den Problemstellungen in modernen IT-Abteilungen. Im Rahmen der durchgeführten Expertenbefragung kann in diesem Zusammenhang gezeigt werden, dass einzelne Lean-Methoden sowohl gezielt in konkreten Handlungsfeldern der IT eine positive Wirkung erzielen können, als auch, dass bestimmte IT-Teilbereiche im Gesamten vom Einsatz etablierter Lean-Methoden profi tieren können. |

|
|
Claas Steffen Gundlach und Alexander Fay
Industrie 4.0 mit dem „Digitalen Zwilling“ gestalten - Eine methodische Unterstützung bei der Auswahl der Anwendungen |
Der Beitrag stellt eine Methode zur systematischen Auswahl von Anwendungen eines „Digitalen Zwillings“ für ein Produkt eines Herstellers vor. Ausgehend von einer von diesem Produkt unabhängigen Recherche von Realisierungen „Digitaler Zwillinge“ werden Anwendungsfälle für das Produkt spezifi ziert und ausgewählt. Die Recherche ist Grundlage der Methode, die unterteilt in drei Phasen eine detaillierte Modellierung dieser Anwendungen ermöglicht. Ergebnis dieser Modellierung ist ein tiefgehendes Verständnis der Anwendungsfälle selbst und ihrer Anforderungen, speziell Informationsforderungen, an den „Digitalen Zwilling“ des Produkts. Diese Erkenntnisse ermöglichen im Weiteren eine effi ziente Konzeptionierung und Implementierung des virtuellen Abbilds des Produkts und können Grundlage der Optimierung der bestehenden Wertschöpfungskette sein |

|
|
Tobias Kopp, Arndt Schäfer und Steffen Kinkel
Kollaborierende oder kollaborationsfähige Roboter? - Welche Rolle spielt die Mensch-Roboter-Kollaboration in der Praxis? |
Kollaborierende Roboter (sog. Cobots) gelten als Zukunftstechnologie für produzierende Unternehmen. Sie zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, eine sichere Hand-in-Hand-Zusammenarbeit mit Menschen ohne physische Trennung zu ermöglichen. In der Praxis fi nden sich zwar erste Anwendungsfälle, in denen Menschen mit Cobots interagieren, nur selten handelt es sich dabei allerdings um Kollaboration im engeren Sinne. Entsprechend stellt sich die Frage, welche Rolle die Kollaborationsfähigkeit von Cobots in der unternehmerischen Praxis spielt und wodurch der Mangel an kollaborierenden Anwendungsfällen begründet ist. Antworten darauf lieferten qualitative empirische Untersuchungen bei vier kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Rahmen des BMBF-Verbundprojekts ProBot. |

|
|
Claus Riehle, Thorsten Pötter und Thomas Steckenreiter
Der Kognitive Loop - Und wie sich „Intelligenz“ auf Siliziumbasis konstelliert |
In der Prozesstechnik denkt man in Produktionsoperationen, die von Sensoren und Aktoren gesteuert bzw. geregelt werden. Und jede Realisierung von Stoffumwandlung basiert auf einem physischen Substrat, was in gleicher Weise für lebende Systeme und ihr Verhalten gilt. Unterschieden werden in dem Beitrag drei Systemebenen: die Funktionsebene, das Interface zur Umwelt und die kognitive Ebene Intelligenz. Mithilfe dieser drei Ebenen lässt sich der Lernzyklus bzw. der bisherige Kognitive Loop sehr gut veranschaulichen. Vergleicht man in dieser Unterscheidungsweise intelligentes Verhalten von Menschen mit den technischen Entwicklungsstufen Maschinisierung, Automatisierung, Regelung und Deep Learning, dann wird das in der kybernetisch-soziologische Systemtheorie gängige Merkmal „operational geschlossen“ verständlich. Daraus wird der Schluss gezogen, dass wir im Rahmen einer digitalisierten Kultur von Produktion und Organisation mit einem neuen Kognitiven Loop auf Silizium-Basis (SI) rechnen sollten. Um diese Analogie hervorzuheben, bezeichnen wir das vom Homo Sapiens entwickelte intelligente Verhalten mit Bio-Informatisierung und die Evolution der sogenannten Künstlichen Intelligenz mit Si-Informatisierung. |

|
|
Sven Reimers und Wolfgang Kersten
Schöne neue Transparenz mit Blockchain? - Warum gerade die Transparenz in der Logistik ein unerwartetes Hindernis darstellt |
Der Blockchain-Technologie wird ein großes Erfolgspotenzial zugesagt, vor allem in der Logistik und dem Supply Chain Management. Deswegen gibt es in diesen Bereichen inzwischen eine kaum zu überblickende Zahl von Blockchain-Projekten sowohl von etablierten als auch jungen Unternehmen. Besonders wird im Folgenden auf das Blockchain-Projekt „Release Order based on Blockchain (ROboB)“ im Hamburger Hafen eingegangen. Die Analyse zeigt auf, dass neben positiven Aspekten die Kerneigenschaften der Blockchain durchaus auch Hindernisse für die Logistik darstellen können. In diesem Beitrag wird daher untersucht, ob die Transparenz eine wichtige Designüberlegung bei der Verwendung von Blockchain in Logistik und Supply Chain darstellt. |

|
|
Felix Eigelshoven, André Ullrich und Norbert Gronau
Konsens-Algorithmen von Blockchain - Eine Betrachtung der Nachhaltigkeit der Konsensfindung |
Neben dem enormen Kursanstieg des Bitcoins in den Jahren 2017/2018, stieg im gleichen Maß auch die benötigte Rechenleistung und der damit verbundene Elektrizitätsbedarf, um Blöcke innerhalb der Bitcoin-Blockchain zu verifi zieren. Aus diesem Problem ableitend beschäftigt sich dieser Beitrag mit der Fragestellung, welchen Beitrag unterschiedliche Konsens-Algorithmen innerhalb einer Blockchain zur Nachhaltigkeit liefern. Im Ergebnis liegt ein Überblick über die meist genutzten Konsens-Algorithmen und deren Beitrag zur Nachhaltigkeit vor. |

|
|
Alexander Belyaev, Christian Diedrich, Holger Köther und Alaettin Dogan
Dezentraler IOTA-basierter Industrie-Marktplatz - Industrie-Marktplatz auf Basis von IOTA, eCl@ss und I4.0-Verwaltungsschale |
Die nächste Generation der industriellen Automatisierung, Industrie 4.0 (I4.0), rückt immer näher. In der Welt von morgen werden die Maschinen nicht nur Anlageninformationen enthalten, sondern auch proaktive Entscheidungs- und Optimierungsalgorithmen, die ein zielgerichtetes Verhalten der Komponenten ermöglichen. Solche I4.0-Komponente können als autonome, unabhängige Wirtschaftsakteure angesehen werden, die nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zusammenarbeiten. |

|
|
Thomas Twenhöven, Björn Engelmann, Julian Kakarott, Kevin Westphal und Moritz Petersen
Blockchain und Privacy - Problemstellung und Lösungen aus Perspektive des HANSEBLOC-Projekts
|
Blockchain ist als Plattform für den Austausch von Daten nach wie vor in aller Munde. Entscheidend für die Akzeptanz der Technologie im geschäftlichen Kontext ist allerdings die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen bzw. die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie der Datenschutzgrundverordnung. Die Blockchain-inhärente Sichtbarkeit aller gespeicherten Daten für alle Teilnehmer, wegen der die Plattform letztlich eingesetzt wird, kann dabei zum Problem werden. In der Praxis werden deshalb verschiedene Verfahren eingesetzt, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ohne dabei die Vorteile einer verteilten Datenbankstruktur einzubüßen. In diesem Beitrag stellen wir entsprechende Verfahren vor und berichten von den Erfahrungen des HANSEBLOC-Projekts, das die Nutzung von Blockchain für den Datenaustausch im Logistikbereich untersucht. |

|
|
Grischa Beier, Malte Reißig, Silke Niehoff und André Ullrich
Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement 4.0 - Informationsdurchgängigkeit mittels Methoden der Wissensrepräsentation |
Der Einfluss der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft ist omnipräsent und kann nicht losgelöst von der Debatte zur nachhaltigen Entwicklung betrachtet werden. Vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 bietet das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement (BNM) besonderes Potenzial, sich den Themen nachhaltiges Wirtschaften und Digitalisierung aus Perspektive der Unternehmen zu nähern. Ein digitalisiertes Nachhaltigkeitsmanagement in industriellen Unternehmen mit Informationen zu unterstützen, bedarf jedoch einer Durchgängigkeit von Informationen. Um diese zu erreichen und zugleich Informationen aus verschiedenen Disziplinen zu integrieren, sind Methoden der Wissensrepräsentation geeignet. Aktuelle Herausforderungen und Ansätze für die Entwicklung eines off enen und konzeptionellen BNM-Modells werden in diesem Beitrag vorgestellt. |

|
|
Dieter Uckelmann, Johannes Tonio Alt und Isabel Andujo
CO2-Berechnungen komplexer Liefernetzwerke - |
In der Folge des fortschreitenden Klimawandels rücken die ökologischen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit verstärkt in den Fokus interner und externer Shareholder [1]. In der Industrie entwickeln sich gleichzeitig immer komplexere Wertschöpfungsnetzwerke. Der Großteil der involvierten Prozesse in einer Wertschöpfungskette wird von global verteilten Partnern ausgeführt. Dieser Trend erschwert die Quantifizierung der Auswirkung einzelner Aktivitäten auf Unternehmensebene an der ökologischen Gesamtleistung der Supply Chain. Der folgende Beitrag untersucht auf Grundlage des SCOR-Models zur strukturierten Erfassung von Emissionsdaten globaler Supply Chains. |

|
|
Felix Klenk, Benjamin Häfner, Gisela Lanza und Markus Wagner
Kreislaufwirtschaft in globalen Wertschöpfungsnetzwerken - |
Die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Produkte mehrfach wertschöpfend dem Produkt- und Produktionslebenszyklus zuzuführen, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Der vorliegende Beitrag präsentiert, basierend auf einer Definition der Kreislaufwirtschaft und ihrer Konzepte, die aktuelle industrielle Praxis zur erfolgreichen Umsetzung und die damit einhergehenden Potenziale. Anschließend werden bestehende technische Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft mit Fokus auf strategische Herausforderungen und „Closing-the-Loop“-Ansätze, analysiert. Der Beitrag soll Entscheidungsträger dabei unterstützen, die Vorteile der Kreislaufwirtschaft zu erkennen und Herausforderungen für eine erfolgreiche Einführung bereits früh anzugehen. |

|
|
Norbert Gronau, Universität Potsdam, Eva-Maria Kern und Hendrik Jonitz
Herausforderungen im Umgang mit Produktionsstörungen - |
Störungen in Produktionssystemen können zu massiven Verlusten für Unternehmen führen. Die Beherrschung der Auswirkungen auftretender Störungen sowie die Störungsprävention sind daher seit langem von hoher Relevanz für produzierende Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Eine Umfrage unter produzierenden Industrieunternehmen zeichnet ein aktuelles Bild des Störungsmanagements und identifiziert relevante Herausforderungen im Umgang mit Störungen in der Produktion. |

|
|
Enzo Weber
Digitalisierung: Der Arbeitsmarkt verändert sich |
Die öffentliche Diskussion über die Zukunft der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung wird von Vorstellungen von selbstfahrenden Autos, menschenleeren Fabriken oder vollautomatischer Logistik dominiert. Dies schafft Ängste vor einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen und einem Rückgang der Beschäftigung in der Zukunft. Gleichzeitig hat dies zu intensiven Debatten über ein bedingungsloses Grundeinkommen geführt: Während die Produktivität steigen würde, würde ein deutlicher Rückgang der Zahl der Arbeitsplätze den Einkommensverteilungsmechanismus in Frage stellen, auf welchem unsere Arbeitsgesellschaften derzeit beruhen. Dieser Beitrag argumentiert, dass die Ersetzung bestehender Arbeitsplätze - oder zumindest von Aufgaben - durch Technologie zwar erfolgen wird und immer stattgefunden hat, dies aber nur eine Seite der Medaille ist. Die Zukunft der Arbeitsmärkte wird komplexer sein. Dies wird in der makroökonomischen, betrieblichen und internationalen Dimension diskutiert. |

|
|
Ronja Ege, Maximilian Kornmann, Clemens Stöver und Dieter Uckelmann
Ökologische Logistikgebäude - |
Wie selbstverständlich sind viele Flächen neben unseren Autobahnen mit Logistikgebäuden besiedelt; doch in der ökologischen Diskussion tauchen häufig “nur” die LKWs auf der Straße auf. So ist die Transportlogistik mit rund 87 % der durch Logistik global freigesetzten Treibhausgasemissionen der Hauptverursacher. Doch auch die 13 %, die auf Logistikimmobilien entfallen, und etwa den jährlichen Emissionen Polens [1] entsprechen, bieten reichlich Verbesserungspotenzial [2]. Auf Basis einer umfangreichen Literaturrecherche, liefert der folgende Beitrag einen Einblick in den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema ökologische Logistikgebäude. |

|
|
Roman Dumitrescu, André Lipsmeier, Thorsten Westermann und Arno Kühn
Digitale Transformation ganzheitlich managen - Wie Unternehmen die digitale Transformation strukturiert meistern |
Digitalisierung ist ein Kernthema, das in den Strategien von Unternehmen berücksichtigt werden sollte. Aufgrund der unternehmensspezifischen Ausgangssituationen und Ziele existiert jedoch kein einheitliches Muster für die digitale Transformation. So sollte jedes Unternehmen seine eigene Strategie für die Gestaltung der Digitalisierung entwickeln. Dabei ist zu festzulegen, in welchen Bereichen ein Unternehmen nutzenstiftende Veränderungen im Kontext der Digitalisierung durchführen will. |

|
|
Timur Ripke und Sven Kägebein
Digitalisierung der Wertschöpfungskette in der Industrie 4.0 - Durchgängige Digitalisierung beseitigt digitale Lücken in Großprojekten – von der Planung bis zum Betrieb |
Großprojekte der Bauindustrie, steigende Komplexitäten von Maschinenbau- und Produktionsanlagen, die Fertigung hochkomplexer Konstrukte sowie unzählige Projektbeteiligte: Alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert bereits in der Planung hohe Genauigkeit. Digitale Mittel helfen dabei, Transparenz zu schaffen, den Überblick über anfallende Daten zu behalten und Fehlerquoten zu minimieren. Die Phase der realen Projektumsetzung prägt jedoch eine digitale Lücke. Digitale Daten, gespeichert und verarbeitet in Termin- und Ablaufplänen, Diagrammen oder CAD-Tools, finden ausgedruckt zurück ins Analoge. Involvierte Personen erfassen und dokumentieren Informationen während der Umsetzung nur auf Papier und nicht digital. Wenn doch, verbleiben Daten isoliert in Systemen. Innovative Projektmanagement-Software sorgt für Datenaustausch in Echtzeit und schließt damit die digitale Lücke. |

|
|
Christoph Pierenkemper, Jannik Reinhold, Roman Dumitrescu und Jürgen Gausemeier Erfolg versprechende Industrie 4.0-Zielposition - Ermittlung unter Berücksichtigung zukünftiger Umfeldentwicklungen |
Mithilfe von Industrie 4.0-Reifegradmodellen können Unternehmen ihren Leistungsstand im Kontext Industrie 4.0 systematisch erfassen. Mit der Ermittlung des Status Quos ist in aller Regel die Frage verbunden „Wo wollen wir zukünftig hin?“. Vor dem Hintergrund, dass Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen nicht immer das grundsätzlich Mögliche einführen können, ist die Beantwortung dieser Frage nicht trivial. Ist sich ein Unternehmen über seine I4.0-Zielposition vermeintlich im Klaren, führen äußere Einflüsse häufig dazu, dass die Zielerreichung erschwert wird, was oftmals eine Anpassung der Zielposition zur Folge hat. Es gilt also, diese Umstände bereits in der Planung zu berücksichtigen. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, wie Umfeldentwicklungen bei der Ermittlung einer Erfolg versprechenden I4.0-Zielposition von Unternehmen einbezogen werden können. |

|
|
Mike Freitag und Stefan Wiesner Smart Service Lifecycle Management Rahmenkonzept und Anwendungsfall |
Die wachsende Menge verfügbarer Daten aufgrund der Digitalisierung der Wertschöpfung beschleunigt den Wandel produzierender Industrien zu Anbietern kundenorientierter Dienstleistungen. Smart Services als digitale Dienstleistungsangebote stehen exemplarisch dafür. Die Analyse von Experteninterviews als auch von Anwendungsfällen aus der Unternehmenspraxis zeigt jedoch, dass das Wissen, wie solche Smart Services entwickelt werden können, immer noch rudimentär ist. In diesem Beitrag wird ein Rahmenkonzept für ein Smart Service Lifecycle Management vorgestellt, das die systematische Entwicklung von Smart Services unter Berücksichtigung von Geschäftsmodellen und des Wertschöpfungsnetzwerks unterstützt. Das Rahmenkonzept wird anhand eines Anwendungsbeispiels aus der Textilindustrie exemplarisch implementiert und validiert. |

|
|
Martin Brylowski, Henning Schöpper und Marwin Krull
Produktmodularisierung entlang der Supply Chain - Wie die Umsetzung gelingt
|
Der fortschreitende technologische Wandel, die Globalisierung der Märkte sowie zunehmend steigende Kundenanforderungen haben zu einem deutlichen Anstieg der Komplexität in produzierenden Unternehmen und deren Supply Chains geführt. Unternehmen und gesamte Wertschöpfungsketten begegnen dieser Entwicklung u. a. mit Produktmodularisierungsstrategien. In diesem Kontext findet jedoch die Untersuchung der Einflüsse von Produktmodularisierung auf die Supply Chain nur wenig Beachtung. Dies kann in der Folge zu ungenutzten Potenzialen und zusätzlichen Risiken, wie dem Verlust der Kernkompetenzen, führen. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit Prozessen und Erfolgsfaktoren, die sich durch eine gemeinsame Betrachtung von Produktmodularisierung entlang der Supply Chain ergeben. Auf Basis einer systematischen Analyse wissenschaftlicher Literatur und leitfadengestützten Experteninterviews wurden ein Vorgehensmodell mit unterschiedlichen Phasen und Schritten erarbeitet sowie die notwendigen Erfolgsfaktoren identifiziert. |

|
|
Ralf Müller-Polyzou, Nicolas Meier, Felix Berwanger und Anthimos Georgiadis
SPS steuern Assistenzsysteme in der Digitalen Fabrik - |
Die Integration industrieller Laser-Assistenzsysteme zur Werkerführung in die Steuerungsebene eröffnet Möglichkeiten der digitalen Transformation für produzierende Unternehmen. Diese Möglichkeiten werden am Beispiel der Digitalen Fabrik der Leuphana Universität Lüneburg dargestellt. In einem Praxisprojekt wird eine manuelle Montagestation mit einem industriellen Laser-Assistenzsystem entwickelt und in die SIMATIC Steuerungsebene der Digitalen Fabrik integriert. Der Werker interagiert mit dem Assistenzsystem und wird von diesem durch den auftragsbezogenen Montageprozess geleitet. Der Werker steht dabei im Zentrum des Geschehens. |

|
|
Dominic Lindner und Michael Amberg
Ist Agilität Voraussetzung oder Folge einer zielgerichteten Digitalisierung? |
Unternehmen befinden sich schon immer in einen konstanten Wandel, welcher heutzutage u. a. eng mit den Schlagworten „Digitalisierung“ und „Agilität“ verknüpft ist. Dabei können agile Methoden speziell in komplexen Projekten Wegbereiter für eine zielgerichtete Digitalisierung sein und andererseits digitale Technologien eine agilere Arbeitsweise fördern. Dieser Beitrag fokussiert durch Gruppendiskussionen mit Managern aus mittelständischen IT-Unternehmen die Frage, ob Agilität Voraussetzung oder Folge einer zielgerichteten Digitalisierung ist. Dieser Beitrag richtet sich an Entscheider aus dem IT-Mittelstand, welche den Grad an Agilität im Unternehmen im Kontext einer zunehmenden Digitalisierung erhöhen möchten. |

|
|
Fabian Behrendt, Niels Schmidtke, Elke Glistau und Margarete Wagner
Der Intelligente Logistikraum: |
Die digitale Transformation der Industrie hat mit ihren technologischen Komponenten einen unmittelbaren Einfluss auf die Ausrichtung der Logistikprozesse innerhalb von Unternehmen sowie in ganzen Unternehmensnetzwerken. Die Entwicklung und Integration neuer Technologien löst dabei mehr und mehr starre Unternehmensstrukturen und Steuerungsarchitekturen auf. Die Vision reicht von dezentralen Netzwerken aus modularer Förder- und Lagertechnik bis hin zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz für smarte Services in der Logistik. Es besteht die Anforderung, die logistischen Objekte zu identifizieren, zu orten, zu steuern und deren Zustände zu erfassen, um eine zielorientierte Interaktion im Sinne einer ganzheitlichen Vernetzung zu bewerkstelligen. |

|
|
Jonathan Krauß, Jonas Dorißen, Hendrik Mende, Maik Frye und Robert H. Schmitt
Maschinelles Lernen in der Produktion - |
Steigende Rechenleistungen und bessere Datengrundlagen bei gleichzeitig sinkenden Kosten für Rechen- und Speicherkapazitäten stellen die Basis für den Einsatz von Machine Learning (ML) in der Produktion dar. Herausforderungen bestehen in der Identifizierung aussichtsreicher Anwendungsgebiete, dem Erkennen der mit diesen verbundenen Learning Tasks sowie dem Aufdecken passender Datensätze. In diesem Beitrag werden daher folgende Fragen beantwortet: Welche Anwendungsgebiete in der Produktion bieten das größte Potenzial für den Einsatz von ML? Welche frei zugänglichen Datensätze eignen sich, um eigene Erfahrungen zu sammeln und welche Learning Tasks sind damit verbunden? Was sind Best Practices für die Anwendungsgebiete? |

|
|
Tobias Rieke und André Sardoux Klasen
Blockchain-Einsatz zur Optimierung von Produktrückrufen |
Blockchains (BC) werden häufig direkt Bitcoin und andere Kryptowährungen verbunden. Dabei stellt BC die Technologie dar, auf der Bitcoin und Co basieren [1] und sind ein Anwendungsbeispiel unter vielen. Die BC besitzt einige Eigenschaften, die auch für das Supply Chain Management relevant sind. Produktrückrufe nehmen aufgrund der komplexen Supply Chains (SC) immer weiter zu. Dabei liegt die Herausforderung darin, einen Produktrückruf effizient vorzubereiten, durchzuführen und anschließend in die Ursachenanalyse einzusteigen. Genau an dieser Stelle kann die BC-Technologie unterstützen und Transparenz schaffen. So kann eine Reaktion schnell, kosteneffizient und situativ angemessen erfolgen. Ziel des Beitrags ist, einen Einblick in das Potenzial von BC für die Herausforderung „Produktrückruf“ zu geben. |

|
|
Feras El Sakka, Timo Busert und Alexander Fay
Systematische Einführung von Industrie 4.0 für den Mittelstand - Anforderungen, Methoden und Anwendungsbeispiel |
In diesem Beitrag wird eine Methodik zur Umsetzung von Industrie 4.0-Projekten im Bereich der Produktion und Logistik beschrieben. Diese Methodik berücksichtigt die besonderen Rahmenbedingungen von KMU und wurde bereits mehrfach in verschiedenen Digitalisierungs- und Industrie 4.0-Projekten mit KMU im Rahmen des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Hamburg angewandt. Der Fokus der Methodik liegt auf einer geeigneten Integration von neuen Technologien in bestehende Systeme sowie der Verbindung neu generierter Daten mit bereits vorhandenen Informationsflüssen. Die Anwendung der Methodik wird exemplarisch anhand eines realen Praxisbeispiels aus dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg dargestellt. |

|
|
Andrea Giusti, Dieter Steiner, Walter Gasparetto, Sebastian Bertoli, Michael Terzer, Michael Riedl und Dominik Tobias Matt
Kollaborative Robotik – Maschinelles Lernen durch Imitation - Flexible Automation für KMUs durch intelligente und kollaborative Roboterassistenten |
Der Trend zur kundenindividuellen Massenproduktion stellt klassische Produktionsmethoden kleinerer und mittlerer Unternehmen vor große Herausforderungen. Branchenübergreifend lässt sich feststellen, dass es für diese Unternehmen besonders schwierig ist mit klassischen Automationslösungen einen tragbaren Kompromiss für den Dreiklang aus hoher Flexibilität, hoher Produktionseffizienz und geringem Investitionsrisiko zu finden. Gleichzeitig stellt die Agilität zur Anpassung an variable Marktbedingungen eine typische Stärke kleiner und mittlerer Unternehmen dar. |

|
|
Christian Knecht und Andreas Schuller
Digitalisierungspotenziale erkennen und nutzen! - Prozessschritte und Problemstellungen von produzierenden KMUs mithilfe von einfach bedienbaren Apps verbessern |
Kleine und mittelständische Unternehmen können das Potenzial der digitalen Transformation nur schwer ausschöpfen. Finanzielle und fachliche Ressourcen stehen nicht in gleichem Maße zur Verfügung wie bei Großunternehmen, wodurch ihnen die konsequente Umsetzung von Lösungen oftmals schwerer fällt. In dem BMBF-Forschungsprojekt »ScaleIT« wurde eine Industrie 4.0-Plattform entwickelt, mit der sich einzelne Prozessschritte mithilfe von Apps verbessern lassen. Es stehen sowohl fertige Apps als auch Open-Source-Hilfsmittel zur einfachen Realisierung neuer Ideen zur Verfügung. Eine im Projekt entwickelte Methodik unterstützt dabei, die größten Digitalisierungspotenziale im Unternehmen aufzudecken. Durch diese Methodik und dem flexiblen App-Ansatz soll es vor allem kleineren Betrieben leichter gemacht werden, neue und sinnvolle Industrie 4.0-Anwendungen auf dem betrieblichen Hallenboden zum Einsatz zu bringen, um so ihre Wertschöpfungskette Schritt für Schritt zu optimieren. |

|
|
Hans Rosenkranz
Gesunder Menschenverstand statt MBA - Daran erkennen Sie gute Führungskräfte |
Es gibt unzählige Werkzeuge für Führungskräfte. Die US-amerikanische Strategieberatung Bain & Company beispielsweise analysiert regelmäßig die 25 beliebtesten Management Tools weltweit. Doch auch das beste Werkzeug ist nur dann gut, wenn es richtig eingesetzt wird. Dazu bedarf es des gesunden Menschenverstands. Einen Manager, der darüber verfügt, erkennt man an folgenden Eigenschaften: Er kennt den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbild, er legt Wert auf eine wertschätzende Feedbackkultur im Unternehmen und er setzt auf die Kraft des Miteinanders. |

|
|
Marcel F. Volland
Hybride Agilität in Großunternehmen - Von der Notwendigkeit des Entlernens |
Viele Großunternehmen müssen sich schnell wechselnden Kundenwünschen und neuen Technologien anpassen, leiden aber gleichzeitig unter einer trägen und dysfunktionalen Organisationsstruktur. Daher ist das Interesse an der IT-Branche gestiegen, um das dort angewendete, agile Arbeiten in die eigenen Strukturen zu implementieren. Eine Tiefenstudie in einem DAX-Unternehmen zeigt, welche Rolle Entlernprozesse bei der Entstehung von hybriden agilen Methoden spielen. |

|
|
Barbara Kump
Der Wandel von Praxis, Wissen und Identität in der Industrie 4.0 - Automatisierung und Digitalisierung verändern nicht nur „was wir tun“ und „was wir können (müssen)“, sondern auch „wer wir sind“ |
Oft wird bei der Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsprozessen übersehen, dass dadurch für die Organisation gravierende Veränderungen angestoßen werden. Dieser Beitrag zeigt auf, dass solche Veränderungen zu einer Inkongruenz zwischen dem „was eine Organisation tut“ (Praxis), „was sie kann“ (Wissen) und „wer sie ist“ (Identität) führen können. Um Veränderungen erfolgreich umzusetzen, müssen diese Inkongruenzen überwunden werden. Wenn Manager sich dessen bewusst sind, können viele Probleme wie z. B. der Zusammenbruch bestehender Routinen, Wissenslücken oder der Abgang von wichtigen Mitarbeitern vorhergesehen und gelöst werden. |

|
|
Wjatscheslav Baumung, Herbert Glöckle und Vladislav Fomin
Blockchain als Enabler eines dezentralen Produktionsnetzwerkes |
Sowohl bei den industriellen als auch wissenschaftlichen Institutionen nimmt die Anwendung der additiven Fertigung stetig zu und ist insbesondere in den Bereichen der Prototypenentwicklung nicht mehr wegzudenken. Die werkzeuglose Herstellung von Teilen, ermöglicht eine dynamische Nutzung der Produktionsressourcen bis unmittelbar zum Fertigungsstart. Dies erlaubt, einerseits in den Bereichen der Feinterminierung und Ablaufplanung, agil auf Veränderungen zu reagieren und andererseits Modelle unterschiedlicher Fertigungsaufträge miteinander zu kombinieren, um somit eine hohe Effizienz der Fertigungsanlagen zu erreichen. Bei der Nutzung von multiplen Anlagen in einem Unternehmen oder im Partnerverbund, stellt die vorhandene Intransparenz Unternehmen und Unternehmensnetzwerke vor viele Herausforderungen. Die Blockchain-Technologie ermöglicht eine gemeinsame Datenbasis zwischen den Teilnehmern. Die Einträge werden protokolliert und die Authentizität der Teilnehmer wird gewährleistet. Dies führt, im Falle der Beziehung zwischen Kunden und Produzenten, zu einer nachprüfbaren Zusammenarbeit, da Unternehmen Dienstleistungsverträge abschließen, die auf dem Fluss vieler kleiner Transaktionen basieren. In diesem Beitrag wird dargestellt, wie verfügbare additive Fertigungsressourcen erkannt werden, sowie, unter der Verwendung der Blockchain-Technologie, in einem dezentralen Produktionsnetzwerk angeboten und von unterschiedlichen Akteuren genutzt werden können. |

|
|
Heiner Heimes, Achim Kampker, Ulrich Bührer und Stefan Krotil
Potenziale und Hürden von Data Analytics in der Serienfertigung - Studienergebnisse aus dem Bereich der Antriebsfertigung von Elektromobilkomponenten |
In der Großserienfertigung von elektrifizierten Fahrzeugen stellt die zunehmende Komplexität eine große Herausforderung dar. Der hohe Prüfaufwand zur Sicherstellung der Qualität des elektrifizierten Antriebsstrangs muss reduziert werden, um auch künftig konkurrenzfähig zu sein. Ein beschleunigter Wissensaufbau bezüglich Fertigungstechnologien und Prozesse kann durch Industrie 4.0-Ansätze, insbesondere Data Analytics, unterstützt werden. Derzeit kann der gewünschte Nutzen von Data Analytics in der Großserienfertigung nicht erzielt werden. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Expertenstudie vorgestellt, die sich mit den Potenzialen und Hürden von Data Analytics in der Großserienfertigung, insbesondere bei der Antriebsfertigung für elektrifizierte Fahrzeuge, befasst. |

|
|
Eike Schäffer, Lars Penczek, Andreas Mayr, Jupiter Bakakeu, Jörg Franke und Bernd Kuhlenkötter
Digitalisierung im Engineering - Ein Ansatz für ein Vorgehensmodell zur durchgehenden, arbeitsteiligen Modellierung am Beispiel von AutomationML |
Die Digitalisierung im Engineering verspricht automatisierte Arbeitsabläufe, höhere Geschwindigkeiten und sinkende Kosten bei der Entwicklung von Automatisierungslösungen. Voraussetzung hierfür ist nicht nur die Modularisierung auf Basis einer strukturierten Beschreibungssprache, sondern auch eine einheitliche, aufeinander aufbauende Modellierung, welche einen automatisierbaren Datenaustausch über die Systemgrenzen hinweg ermöglicht. Um eine breite Anwendung zu erzielen, sollte die zugrundeliegende Ontologie auf bestehenden Normen und Standards aufbauen und in Open-Source-Anwendungen zur Verfügung stehen. Für die kollaborative und konsistente Entwicklung einer solchen Ontologie bedarf es eines strukturierten, methodischen Vorgehens sowie einer damit verbundenen Modellierungslandkarte, welche als Orientierung zur standardisierten, arbeitsteiligen Modellierung dient. Ein möglicher Ansatz für das benötigte Vorgehensmodell sowie der zugehörigen Landkarte wird im Rahmen dieses Beitrags vorgestellt und unter Verwendung von AutomationML validiert. Der vorgestellte Ansatz soll eine mögliche Richtung aufzeigen und weitere prozessgesteuerte Modellierungsbestrebungen von Ontologien anregen. |

|
|
Ralf Müller-Polyzou, Lucas Meyer und Anthimos Georgiadis
MES-Betriebsmittelintegration aus Anwendersicht - Eine praxisbezogene Analyse in produzierenden Unternehmen am Beispiel eines Laser-Assistenzsystems |
Das Zusammenwirken von Manufacturing Execution Systemen (MES) und Betriebsmitteln gilt im Sinne der Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der Produktion als Voraussetzung für die Smart Factory der Industrie 4.0. Der Beitrag beschreibt die praxisbezogene Analyse einer MES-Betriebsmittelintegration am Beispiel eines industriellen Laser-Assistenzsystems zur Werkerführung. Die Situation und Anforderungen aus Anwendersicht werden unter Berücksichtigung der eingesetzten Systeme, Schnittstellen, Protokolle sowie von Plug & Produce untersucht. Die Ausarbeitung basiert auf einer qualitativen Analyse mit Meinungsbildnern und einer quantitativen Analyse mit führenden Unternehmen unter anderem der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Die Studie leistet damit eine Hilfestellung für MES-Investitionen in der Industrie 4.0. |

|
|
Andreas Deuter und Florian Pethig
The Digital Twin Theory - Eine neue Sicht auf ein Modewort |
Im digitalen Zwilling wird ein wesentliches Mittel für Produktivitätssteigerungen im Zeitalter der industriellen Digitalisierung gesehen. Daher beschäftigen sich zahlreiche Publikationen mit diesem Begriff. Dieser Beitrag zeigt zunächst die Ursprünge des Begriffs und setzt sich mit ausgewählten Definitionen auseinander. Diese unterstützen allerdings wenig bei der praktischen Implementierung von digitalen Zwillingen, da sich die Definitionen zum Teil stark unterscheiden. Als Alternative zu einer klassischen Definition wird daher ein Theoriemodell vorgeschlagen, das Annahmen über den digitalen Zwilling enthält. Dieser neuartige Denkansatz soll helfen, das Management von digitalen Zwillingen in der Praxis zu verbessern. |

|
|
Frederik Schmatz, Jens Meißner, Jan Sender, Wilko Flügge und Eugen Gorr
Mensch-Roboter-Kollaboration in der Flugzeugendmontage - Ein intelligentes Assistenzsystem für das mechanische Fügen in der manuellen Montage
|
Viele Montageprozesse im Flugzeugbau laufen manuell ab. In der Endmontage der Airbus A320-Familie werden unter anderem die Längsstreben, sogenannte Stringer, am Querstoß zweier benachbarter Flugzeugrumpfsektionen über Stringerkupplungen miteinander verbunden. Hierfür werden derzeit herkömmliche Vollniete eingesetzt. Zukünftig wird hier ein Wechsel auf Vollstanzniete angestrebt. Aufgrund hoher Prozesskräfte beim Stanznieten weisen die Werkzeuge ein hohes Eigengewicht auf, wodurch die Montage zu hohen physischen Belastungen der Mitarbeiter während der manuellen Handhabung führen würde. Ein innovatives Assistenzsystem auf Basis eines kollaborierenden Roboters soll Abhilfe schaffen. Durch eine intelligente Steuerung soll es darüber hinaus die Qualitätssicherung maßgeblich unterstützen. Das System ist Gegenstand dieses Beitrags. |

|
|
Volker Gruhn
Künstliche Intelligenz verleiht Cyber-Physical Systems Flügel
|
Cyber-Physical Systems (CPS) sind ein Beispiel für die immer engere Verbindung von digitaler und realer Welt. Denn in CPS werden Abläufe und physische Gegenstände unmittelbar in digitale Prozesse integriert. Für IT-Experten bedeutet das mehr Komplexität in der Entwicklung von IT-Systemen. Denn die bisherige Modellbildung, mit der sie gearbeitet haben, stößt angesichts der Unordnung in der realen Welt an ihre Grenzen. Künstliche Intelligenz (KI) hilft dabei, diese Komplexität zu beherrschen und so den Einsatz von CPS zu erleichtern beziehungsweise zu ermöglichen. Die Stärke von CPS liegt insbesondere im Finden von Optimierungspotenzialen, im Erkennen von Mustern und in der engen Zusammenarbeit mit Menschen. Verfahren wie Machine Learning, das die Grundlage für beispielsweise Bilderkennung oder Spracherkennung liefert, erlauben einerseits engere Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch und CPS. Andererseits erhöhen diese Techniken den Autonomiegrad, mit dem CPS arbeiten können. In Summe entstehen dank KI neue Einsatzszenarien. Die Kombination dieser Technologien stößt die Tür für die Fabrik der Zukunft auf. Diese Entwicklung muss sich auch in den zugrundeliegenden IT-Systemen niederschlagen, die Unternehmen aufbauen. Die Verantwortlichen müssen Strukturen schaffen, in denen klassische Informationssysteme, CPS und Cognitive Computing Systems integriert zusammenarbeiten können. |

|
|
Norbert Gronau Der angemessene Grad von Autonomie in Cyber-Physischen Produktionssystemen |
Existierende Fabriken weisen häufig hierarchische Strukturen bei Entscheidungsfindung und Steuerung auf. Cyber-Physische Systeme ermöglichen es prinzipiell, den Grad an Autonomie bei Entscheidungsfindung und Steuerung zu erhöhen. Unklar ist allerdings bisher weitgehend, bis zu welchem Grad Autonomie tatsächlich nützlich ist. Dieser Beitrag differenziert unterschiedliche Definitionen von Autonomie und Ansätze, diese zu erreichen. Erste experimentelle Erkenntnisse in einer Laborumgebung helfen, die aufgestellten Fragen zu beantworten. |

|
|
Roman Dumitrescu, Thorsten Westermann, Tommy Falkowski Autonome Systeme in der Produktion Planungssystematik für die Entwicklung autonomer Systeme |
Autonome Systeme werden perspektivisch alle Lebensbereiche durchdringen und haben das Potenzial, einen gesellschaftlichen Wandel auszulösen. Die Konzipierung dieser hochkomplexen Systeme erfordert leistungsfähige Entwicklungsansätze und -methoden, die disziplinübergreifend angewendet werden. Stellvertretend für die vielschichtigen Anwendungsbereiche von autonomen Systemen steht die industrielle Produktion, in der im Kontext von Industrie 4.0 bereits eine technologieinduzierte Transformation eingeleitet wurde. |

|
|
Tobias Fischer und Jürgen Köbler
Lean-Management und Industrie 4.0 - Warum Lean-Management eine solide Grundlage für die vierte industrielle Revolution darstellt |
Einerseits ist die vierte industrielle Revolution derzeit das Thema der Indus- trie, andererseits stellen renommierte Gesellschaften und Unternehmensberatungen einen nicht zufriedenstellenden Implementierungsgrad der gängigen Lean-Methoden fest. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine Umsetzung dieser Lean-Methoden sinnvoll für den Einzug der Industrie 4.0 ist oder ob diese Methoden sogar als Voraussetzung angesehen werden können. Hierzu wurden alle gängigen Prinzipien und Methoden des Lean-Managements mit den Prinzipien und Technologien der Industrie 4.0 gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass LeanManagement eine solide Basis für die erfolgreiche Implementierung der vierten industriellen Revolution für die Produktion der Zukunft ist. Lean-Management kann bzw. muss sogar letztlich als eine essenzielle Voraussetzung gesehen werden. |

|
|
Gökhan Cenk, Emre Kayadelen, Philipp Kürner, Marius Schultenkämper und Dieter Uckelmann
Ökologische Aspekte des Vendor Managed Inventory |
Moderne Logistikkonzepte spielen angesichts der weltweit zunehmenden Transportleistung aus ökonomischer Sicht bei Unternehmen eine essenzielle Rolle. Hohe Zeitersparnis, schnellere Lieferfähigkeit und reduzierte Bestände bewirken eine schlankere Supply Chain, wodurch hohe Kosteneinsparungen mit einhergehen [1]. Die daraus resultierenden Umweltauswirkungen (z. B. im Hinblick auf die Anzahl der Transporte, Energiebedarf - und Flächenverbrauch durch Logistikflächen) werden bisher wenig betrachtet und werfen die Frage auf, inwiefern Unternehmen Vendor Managed Inventory (VMI) auch aus ökologischer Sicht betrachten. Die vorliegende Studie untersucht das dort in Unternehmen vorhandene ökologische Bewusstsein zum Einsatz von VMI. Basierend auf einer Umfrage in der Logistikbranche in Deutschland wurden die Ergebnisse analysiert, zusammengefasst und als Handlungsempfehlungen herausgegeben. |

|
|
Anuschka Huber, Helen Mödinger und Dieter Uckelmann
Soziale Netzwerke in Logistik und Industrie 4.0 – Neue Kommunikationsformen in Produktion und Logistik |
Die rasante Weiterentwicklung von Technologien ermöglicht Unternehmen neue Formen der Kommunikation über Soziale Netzwerke zu erschließen. Soziale Kommunikationsmedien können einen Beitrag leisten die Effizienz im Unternehmen zu erhöhen und eine Verbindung zu Partnern und Kunden herzustellen [1]. Dieser Beitrag gibt Aufschluss, wie Soziale Netzwerke die Kommunikation im Unternehmen intern und extern, mit Fokus auf Logistik und Produktion, unterstützen können. In diesem Zusammenhang werden Praxisbeispiele aufgezeigt und ein entsprechendes Modell entwickelt. |

|
|
Severin Weiss
Futter fürs Hirn – Industrie 4.0 für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
|
Das Ziel, Industrie 4.0 als digitale Agenda in sämtlichen produzierenden Betrieben zu implementieren und so die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, gilt selbstverständlich auch für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Verändertes Konsumentenverhalten, gesetzliche Vorgaben sowie die wachsende Spezialisierung stellen die Branche dabei vor immer neue Herausforderungen. Auch wenn die Automatisierung von Anlagen schon oft umgesetzt ist, fehlt es aber in vielen Fällen noch an der strukturierten Integration in ein gesamtheitliches Datenkonzept. Durch die digitale Vernetzung aller Prozesse bieten sich hier innovative Lösungen. Was Industrie 4.0 für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bedeutet, wo die Chancen liegen und welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung es gibt, ist Thema dieses Beitrags. |

|
|
Carsten Feldmann und Ralf Ziegenbein
Digital Lean – Mit dem Crossroads-Modell zu mehr Effizienz - Erklärung und Auswahl von Steuerungsansätzen für Produktions- und Logistiksysteme in Zeiten der Digitalisierung |
Methoden zur Überwachung und Steuerung von Materialflüssen in einem Produktions- oder Logistiksystem sollen Ziele wie niedrige Kosten und kurze Durchlaufzeiten unterstützen. Die Steuerungsprinzipien der Lean Production zielen auf dezentrale, bedarfsorientierte Selbstorganisation der Prozesse, zum Beispiel in einem Kanban-Regelkreis. Die Ansätze der Industrie 4.0 setzen auf digitale Vernetzung von Maschinen, Produkten und Mitarbeitern sowie den Einsatz von Sensorik. Welcher Steuerungsansatz passt zu welchem Produktportfolio? Lassen sich die Ansätze kombinieren – schlank durch Digitalisierung? Das Crossroads-Modell erklärt anschaulich die Unterschiede der Steuerungsansätze und leitet konkrete Handlungsempfehlungen für die Unternehmenspraxis ab. |

|
|
Till Becker, Thorben Funke und Joshua Coordes
Auslastungsmessung in LKW-Laderäumen - Ein Überblick über vorhandene Technologien und ein Praxistest mit Ultraschallsensorik in der Automobillogistik
|
Cyber-Physische Systeme ermöglichen Unternehmen die virtuelle Abbildung von realen Prozessen, wodurch Produktions- und Logistiksysteme effizienter überwacht und gesteuert werden können. Diese Steigerung der Prozesstransparenz wird durch immer günstiger werdende Sensoren und Aktoren ermöglicht. Deren Einsatz gewinnt auch in der Transportlogistik und vor allem im Bereich des Straßengüterverkehrs an Bedeutung, wie die voranschreitende Entwicklung von Telematiksystemen [1] zeigt. Ein Aspekt ist hierbei die Überwachung von LKW Laderäumen in Bezug auf ihre Auslastung. Diese Daten ermöglichen neben Kostenvorteilen auch eine Emissionsreduktion und eröffnen neue Möglichkeiten im Bereich der Prozesssteuerung. Dieser Bericht gibt einen Überblick über vorhandene und mögliche Technologien und stellt die Ergebnisse eines ersten Praxistests in der Versorgungslogistik bei einem deutschen Automobilhersteller vor, für den Ultraschallsensoren in Kombination mit einem Mikrocontroller mit Mobilfunkanbindung eingesetzt wurden. |

|
|
Dietlind Ruoff, Patricia Srsa und Dieter Uckelmann SupplyOn - Netzwerk für den elektronischen Datenaustausch in der Zulieferindustrie
|
In den vergangenen Jahren sind das E-Business und die Vernetzung zwischen Unternehmen zu einem immer wichtigeren Aspekt geworden. Gleichzeitig mit dem E-Business hat sich auch der elektronische Datenaustausch weiterentwickelt, der die Netzwerkbildung unterstützt. Durch vielseitige Lieferantenportale besteht somit nicht mehr nur die klassische 1:1 EDI-Kommunikation zwischen Hersteller und Zulieferern. Der folgende Beitrag beleuchtet diese Entwicklung auf Basis einer ausführlichen Literaturrecherche näher und geht dabei auf verschiedene Möglichkeiten des Datenaustauschs und die Unterschiede zum klassischen EDI ein. |

|
|
Marcus Lewin und Alexander Fay
Charakteristik intelligenter Objekte in einer digitalisierten Logistik
|
Im Zuge der Digitalisierung und Industrie 4.0 werden Objekte und Systeme in der Logistik zunehmend mit Informations- und Kommunikationstechnologien ausgestattet, was mit neuen Funktionalitäten einhergeht. Solche intelligenten Objekte ermöglichen innerhalb von Supply Chains eine hochauflösende Darstellung von Prozessen und unterstützen deren Steuerung. Parallel steigen die Möglichkeiten und Varianten bei der technischen Gestaltung und Integration von intelligenten Objekten. Dies stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen in der Beherrschung der steigenden Komplexität. Zur Handhabung dieser Komplexität wird in diesem Beitrag ein Ansatz zur systematischen Strukturierung von Objekten in einer vernetzten Logistik hinsichtlich Funktion, Aufbau sowie Abhängigkeiten in einem Gesamtsystem vorgestellt. |

|
|
Paul Motzki, Steffen Hau, Marvin Schmidt und Stefan Seelecke
Künstliche Muskeln und Nerven in Industrie 4.0 Konzepten – Multifunktionale Aktor-Sensor-Systeme mit Formgedächtnislegierungen und dielektrischen Elastomeren |
Innerhalb der Konzepte von Industrie 4.0 steht der Begriff Smart Factory für die Schaffung von effektiven Produktionsumgebungen durch Digitalisierung und Cyber-Physische Systeme. Fertigungsanlagen sollen stärker automatisiert, flexibel und adaptiv werden. Im Zuge dieser Bestrebungen geraten auch intelligente Materialien immer mehr in den Fokus der Industrie. Kombinierte aktorische und sensorische Eigenschaften ermöglichen den Aufbau leichter und kompakter multifunktionaler Aktor-Sensor-Systeme, welche zudem energieeffizient, geräusch- und emissionslos betrieben werden. Dadurch bieten sie sich insbesondere für den Aufbau vernetzter Systeme an. Speziell Formgedächtnislegierungen (FGL) und dielektrische Elastomere (DE) eignen sich für den Aufbau intelligenter Aktoren und werden anhand von einigen Anwendungsbeispielen in diesem Beitrag vorgestellt. |

|
|
Welf-Guntram Drossel, Holger Kunze und Martin Ettrichrätz
Passive Strukturen zum Leben erwecken – Durch Verschmelzen von Struktur und Funktion auf Werkstoffebene Systeme mit geringer Komplexität aber hoher Funktionalität schaffen |
Der Mensch mit seinen Bedürfnissen ist die wesentliche Triebkraft für Innovationen. Er misst den Nutzen von Produkten an den Kriterien Funktionalität, Bezahlbarkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Im Bestreben, allen Forderungen gleichermaßen gerecht zu werden, werden Produkte und Prozesse zunehmend komplexer. Der Aufwand zur Problemlösung steigt überproportional und die Entwicklungsdynamik fällt steil ab. Mit intelligenten Materialien/Funktionswerkstoffen/smart materials ist eine Transformation von Funktionalitäten auf die Werkstoffebene möglich. Ein Paradigmenwechsel im Produkt – die Verschmelzung von Funktion und Struktur – wird möglich. Damit kann eine neue Qualität im Produktdesign erreicht werden. Die Form folgt |
Manuel Rupprecht